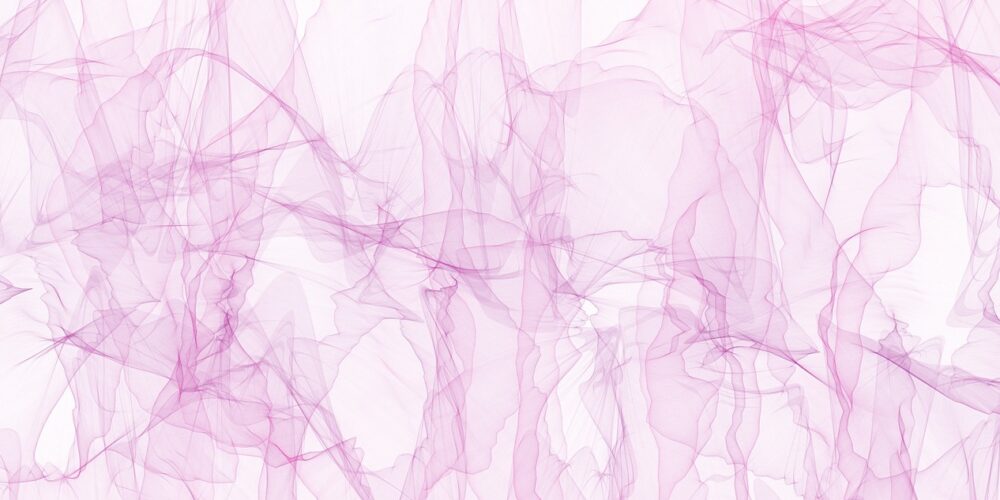
Neue Medienobservationen-Sonderausgabe (16. September 2022)
Macht. Mode. Männer.
Zwischen (GESPRÄCHS)stoff, (TEXT)ilien, und Haute-(CULTURE).Herausgegeben von Julia Lebe
Bild: Pixabay

Neue Medienobservationen-Sonderausgabe (6. Mai 2022)
Textbegriffe – interdisziplinär. Was ist Text? Wie ist Text? Wann ist Text?Herausgegeben von Doris Pichler

Neue Medienobservationen-Sonderausgabe (21. Dezember 2020)
Jenseits-Zeit & Geistes Reich. Zeitlichkeit im OkkultismusHerausgegeben von Kay Wolfinger

Neue Medienobservationen-Sonderausgabe (April 2020)
Fake.Herausgegeben von Julia Lebe
Bild: Johanna Warda

Neue Medienobservationen-Sonderausgabe (30. April 2020)
Spürtechniken. Von der Wahrnehmung der Natur zur Natur als MediumHg. von Birgit Schneider und Evi Zemanek
Foto: Birgit Schneider, Nachbearbeitung: Martin Hinze
Von Kino-Wochenschau bis TV-Serien: Gerhard Trede und der ‚ambient‘ Sound der 1950er und 1960er-Jahre
Sigrun Lehnert, 18. Januar 2024 , Musik
Die musikalische Begleitung von Film und Fernsehen hat Ähnlichkeiten zur Musik in öffentlichen Räumen. In beiden Fällen wird Musik genutzt, um Emotionen zu lenken, Atmosphäre zu schaffen und ein Gesamterlebnis zu bieten. Die Gestaltung von Hintergrundmusik begann bereits mit Erik Satie im späten 19. Jahrhundert und setzt sich bis heute fort mit Komponisten wie Brian Eno. Die Bezeichnungen für diese Bandbreite von Musik lauten ‚Production Music‘, ‚Library Music‘, ‚Ambient Music‘ oder ‚Muzak‘. Der Hamburger Gerhard Trede etablierte sich in den 1950er-Jahren vor allem als Hauskomponist der Deutschen Wochenschau GmbH. Seine Musik prägte nicht nur Kinofilm und Fernsehen in Westdeutschland, sondern auch das musikalische Unbewusste eines internationalen Publikums, und wirkt bis heute nach: nicht zuletzt in der digitalen Vermarktung oder durch Neuarrangements seiner Stücke.
Dieser Artikel erschien am 17.01.2024 in der Zeitschrift Medienobservationen.
Er ist durch die DNB archiviert. urn:nbn:de:101:1-2024010915514218188587
DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/21645
20240117LehnertDas Böse, vor dem Gesetz. Konfigurationen der Gewalt in Stanley Kubricks A Clockwork Orange (1971)
Michael Braun, 7. November 2023 , Allgemein
Dieser Artikel erschien am 07.11.2023in der Zeitschrift Medienobservationen.
Er ist durch die DNB archiviert. urn:nbn:de:101:1-2023102612281457823649
DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/20115
20231107braunFranz Kafkas und Ernst Jüngers Käfer – Käfermysterium und existentielle Wahrnehmung
Siegfried Graf, 31. Oktober 2023 , Buch
Dass Ernst Jünger, von seinen frühen Tagen in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs an, ein genauer Beobachter von Insekten war, der sich später zu einem veritablen Entomologen entwickelte und seine subtilen Jagden immer mehr verfeinerte, ist bekannt. Damit scheint Kafkas Käfer aus seiner Novelle
Dieser Artikel erschien am 31.10.2023 in der Zeitschrift Medienobservationen.
Er ist durch die DNB archiviert. urn:nbn:de:101:1-2023102412271295487125
DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/20114
20231031grafDie Mauer, der Kalte Krieg und unbotmäßige Agenten im Film (Der Spion, der aus der Kälte kam, 1965, Bridge of Spies und Deutschland 83, 2015)
Michael Braun, 24. Oktober 2023 , Kino, TV
Die Mauer, die Deutschland von 1961 bis 1989 teilte, ist ein Geschichtszeichen des Kalten Krieges. Im Agentenfilm ist diese Teilung oft genug für die Plotline verantworlich. Der vorliegende Beitrag untersucht im Vergleich der Agentenfilme
Dieser Artikel erschien am 24.10.2023in der Zeitschrift Medienobservationen.
Er ist durch die DNB archiviert. urn:nbn:de:101:1-2023101623521476608052
DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/20088
20231024braunMerging of Realities: The ‘Non’-America in Roman Polanski’s The Ghost Writer.
Sebastian Stoppe, 15. September 2023 , TV
Most of the plot of the 2010 film
Dieser Artikel erschien am 13.09.2023 in der Zeitschrift Medienobservationen.
Er ist durch die DNB archiviert. urn:nbn:de:101:1-2023090514073628960083
DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/20024
20230913Stoppe„Talking to you scares me“. Zur dokumentarischen Inszenierung von Natürlichkeit und verschwörungstheoretischem Denken in Pandamned (2022)
Elias Fromm, 2. August 2023 , TV
Der mediale Raum der Verschwörungsgläubigen hat durch die Corona-Pandemie an Aufmerksamkeit gewonnen. Ein nicht zu vernachlässigender Teil dieses Raumes sind dabei Dokumentationen, die die Validität der eigenen Überzeugungen bestätigen sollen. An der beispielhaften Analyse einer dieser Dokus,
Dieser Artikel erschien am 02.08.2023 in der Zeitschrift Medienobservationen.
Er ist durch die DNB archiviert. urn:nbn:de:101:1-2023072612392963704119
DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/12345
20230802FrommLoblied auf die Melancholie
Bernd Scheffer, 3. Juli 2023 , Allgemein
Der Text singt – mit vielen literarischen Beispielen aus einer langen kulturellen Tradition der Melancholie – ein Loblied auf die Melancholie, indem sie von der Depression abgehoben, vor allem aber, indem sie gegen das positiven Denken und den maßlosen Optimismus ins Feld geführt wird. Die positiven Effekte der Melancholie, der Zweifel, die Nachdenklichkeit, wirken gerade in Krisenzeiten. Doch Vorsicht und Kritik ist dort geboten, die sie ihre Sensibilität verliert, zur Pose erstarrt und wo sie überschwänglich gefeiert wird.
Dieser Artikel erschien am 03.07.2023 in der Zeitschrift Medienobservationen.
Er ist durch die DNB archiviert. urn:nbn:de:101:1-2023062812150763346390
DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/19715
20230703SchefferWiederholung, Variation und Selektion: Serienevolution und Paratext am Beispiel von Ms. Marvel
Laura Désirée Haas, 24. März 2023 , Comics
Die aktive Partizipation der Rezipierenden an der Produktion populärer Kultur ist oft behauptet, aber seltener nachgewiesen worden. Der vorliegende Beitrag unternimmt am Beispiel der Comic-Serie
Dieser Artikel erschien am 24.03.23 in der Zeitschrift Medienobservationen.
Er ist durch die DNB archiviert. urn:nbn:de:101:1-2023032011294575618614
DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/19380
20230324haasVom Ende der Parabel. Rian Johnons fun murder mysteries Knives Out (2019) und Glass Onion (2022)
Michael Braun, 8. März 2023 , Kino
Dieser Artikel erschien am 08.03.2023 in der Zeitschrift Medienobservationen.
Er ist durch die DNB archiviert. urn:nbn:de:101:1-2023030810240620436726
DOI: https://doi.org/10.19359/mediarep/20538
20230308braun„Stell ́ dir vor, es ist Krieg, und keiner weiß, was er anziehen soll.“ Oder eine kleine Geschichte der Uniform anhand der Barbourjacke
Julia Lebe, 16. September 2022 , Macht. Mode. Männer., Sonderausgaben
Die Barbourjacke ist ein einzigartiges Kleidungsstück. An ihr lassen sich realhistorische Übergänge von Kleiderordnungen in die Mode ablesen. Darüber hinaus kann sie auch die entgegengesetzte Richtung von Mode zurück zur Kleiderordnung – sowie zum Spezialfall Uniform – sichtbar machen. Christian Kracht nutzt die Barbourjacke als Motiv in seinem Roman
Dieser Artikel erschien am 16.09.2022 in der Zeitschrift Medienobservationen.
Er ist durch die DNB archiviert. urn:nbn:de:101:1-2022091913331091176524
DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/18958
20220916lebe